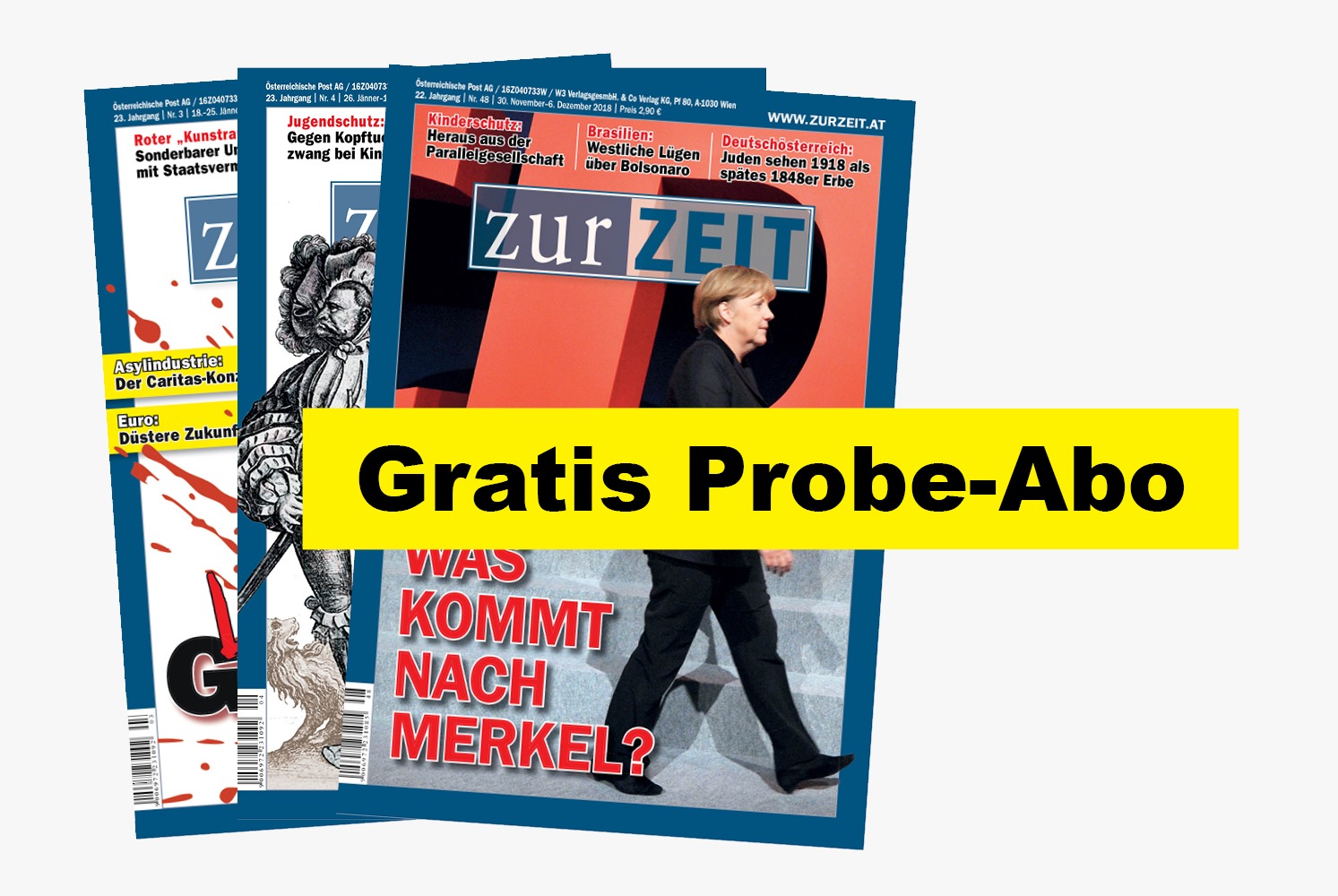Autor: A.R.
Ein historisches Debakel: Noch nie scheiterte ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang. Ein souveräner Machtantritt sieht anders aus.
Union und SPD verfügen gemeinsam über 328 Stimmen, Merz bekam im zweiten Wahlgang gerade einmal drei mehr als notwendig. Ein Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Dass man einen zweiten Wahlgang überhaupt nötig machte, zeigt die Instabilität des neuen Bündnisses aus CDU/CSU und abgewählter SPD.
Während Unionsfraktionschef Jens Spahn die Reihen geschlossen halten wollte, sprach CSU-Chef Söder salbungsvoll von „Besonnenheit“ – was in Wahrheit eher die Suche nach dem politischen Pflaster für einen offenen Riss war. Die Grünen hielten ihre Linie und verweigerten Merz erneut die Unterstützung. Grünen-Fraktionschefin Dröge bekräftigte, dass ein Kanzler Merz für sie keinen „Vertrauensvorschuss“ verdiene. Auch von der Linken kam gewohnt populistische Ablehnung.
Die AfD hingegen reagierte nüchtern: Alice Weidel schrieb auf X, dass das Scheitern im ersten Wahlgang beweise, wie wacklig das Fundament dieser „kleinen Koalition“ sei. Man kann dem kaum widersprechen.
Fakt ist: Merz hat sich ins Kanzleramt gezittert. Doch Vertrauen und Autorität gewinnt man nicht durch das Zusammenzählen von Stimmen, sondern durch Klarheit und Rückgrat. Beides scheint dieser Start zu vermissen. Ein Kanzler, der bereits vor Amtsantritt von der eigenen Koalition misstrauisch beäugt wird, beginnt seine Amtszeit nicht mit Stärke – sondern mit einem Fragezeichen.